Die Erneuerung des Wohnens
Doppelseite aus dem Buch «The Renewal of Dwelling» mit dem Edifício Parnaso, einem bemerkenswerten Wohnbau in Porto (Foto: © Triest Verlag)
Elli Mosayebi forscht, unterrichtet und baut. Als ETH-Professorin setzt sie auf den Austausch zwischen unterschiedlichen Disziplinen und Kompetenzen. In ihrem neusten Buch hat sie gemeinsam mit Michael Kraus das europäische Wohnen der Nachkriegszeit untersucht.
Frau Mosayebi, Sie forschen schon seit längerer Zeit über Wohnformen und haben in Ihrer Praxis als Architektin auch Resultate dieser Forschungen einfliessen lassen. Nun erscheint demnächst das Buch «The Renewal of Dwelling» (Die Erneuerung des Wohnens). Worum geht es darin?
Das Buch befasst sich mit Wohnbauten, die zwischen 1945 und 1975 in verschiedenen europäischen Städten gebaut wurden. Überspitzt formuliert lässt sich sagen, Europa wurde in dieser Zeit neu gebaut. Dies hat mit den immensen Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs und mit dem Nachkriegsboom bis 1973 zu tun. Uns interessierte, ob und wie diese massive Rekonstruktion und Erweiterung des Bestands auch eine Erneuerung der Wohnformen mit sich brachte. Wir haben versucht, Projekte in europäischen Städten ausfindig zu machen, die diese Erneuerung beispielhaft vorführen. Dabei haben wir uns bewusst nicht auf die Metropolen wie London, Paris oder Wien konzentriert, sondern auf Städte, die eher in der zweiten Reihe des internationalen Diskurses standen und deren architektonische Projekte uns weniger bekannt schienen.
Geht es bei der Forschung zum Thema Wohnformen um soziologische Fragen oder stehen Entwurfsfragen im Vordergrund?
Im Buch hat jede Stadt einen Katalog mit beispielhaften Wohnbauten, wobei unser Erkenntnisinteresse auf räumlichen Erneuerungen lag. Damit meine ich städtebauliche, grundrissbezogene und materielle Aspekte des Räumlichen, die als Antwort auf die drängenden sozialen, ökonomischen und bautechnischen Herausforderungen der Zeit realisiert wurden. Den Katalog ergänzen Essays zu jeder Stadt, welche die Rolle des Staates untersuchen, angefangen bei der Koordination von Wohnbauprogrammen bis hin zur Einflussnahme auf den privaten Raum der Wohnungen.
Im Unterschied zu früher erscheint uns heute in der Praxis die Frage der Wohnform von realen demografischen Entwicklungen entkoppelt. Dies hat sicherlich mit der Bequemlichkeit gewisser Investoren zu tun. Die Entkoppelung ist aber auch Ausdruck der Individualisierung der Gesellschaft, woraus sich keine scharfen Benutzer*innenprofile ableiten lassen. Jeder und jede hat eine eigene Vorstellung davon, wie sie oder er wohnen möchte, das stellen wir besonders dann fest, wenn wir unsere in Gebrauch befindlichen Wohnungen besichtigen.
Der gegenwärtige Pluralismus von Lebensformen lässt sich im Übrigen auch in den Ausschreibungen nachlesen. So gibt es heute kaum einen Wohnungsbauwettbewerb, in dem die Frage der Flexibilität nicht gestellt wird. Die Forderung nach Offenheit und Aneignungsfähigkeit gegenüber verschiedenen Nutzeransprüchen ist Ausdruck der hohen Diversität. Wir finden, das ist eine der grösseren Herausforderungen für Architekt*innen. Schliesslich wollen wir keine generischen Häuser bauen.
In Ihrem Projekt «Ein performatives Haus» haben Sie genau solche Themen ausgelotet. Was waren Ihre Beobachtungen diesbezüglich? Wie sind Sie damit umgegangen?
Eine wichtige Beobachtung war, dass eben auch die Singlehaushalte sehr divers sind: Es gibt sehr viele Gründe, weswegen immer mehr Menschen alleine leben. Diese Entwicklung ist mitunter ein Grund für den Anstieg des Flächenverbrauchs im Wohnen. Wir fanden es wichtig, für diese Gruppe eine Wohnung zu entwerfen, die über flexible Elemente an unterschiedliche Bedürfnisse anpassbar ist. Wir fragten uns zudem, ob wir über die beweglichen Elemente den Möglichkeitsraum im Kleinwohnungsbau vergrössern können, wobei auch eine spielerische Komponente hinzukam, denn performativ bedeutet tänzerisch, beweglich und vielgestaltig. Die beweglichen Wände schliessen ja nicht vollständig ab. Es sind visuelle Abschlüsse, keine akustischen.
Uns interessierte der lockere Umgang mit den Hierarchiestufen im Wohnen von öffentlich bis privat, auch weil man sich in einem Singlehaushalt meistens alleine aufhält. Diese wandelbaren Elemente nennen wir bewusst nicht flexibel. Flexibilität ist ein Konzept, das für das Effizienzdenken der Moderne steht, welche die Bewohner*innen nicht selten auch in ihren alltäglichen Bewegungsabläufen disziplinieren wollte. Es ging vielmehr um das Lustvolle, Intensive und Ereignisreiche.
Beim Wohnhaus an der Stampfenbachstrasse in Zürich flossen die Resultate der Wohnforschung von Edelaar Mosayebi Inderbitzin (EMI) ein. (Foto: Roland Bernath)
Wurden denn die wandelbaren Elemente auch tatsächlich genutzt?
Ja, wir hatten in diesem Prototyp 87 Bewohner*innen verschiedener Altersgruppen. Sämtliche beweglichen Elemente wurden mit Sensoren ausgestattet, um alle Bewegungen in der Wohnung zu messen. Wir haben sehr viele Daten produziert, die Resultate sind übrigens online. Es zeigte sich, dass es einen äusseren Anlass braucht, damit etwas bewegt wird, etwa den Tag-Nacht-Wechsel oder eine Person, die zu Besuch kommt. Das entsprach auch unseren Erwartungen. Der Kühlschrank wurde übrigens am meisten benutzt. Die Drehwand kam an dritter Stelle. Uns hat erstaunt, dass immer noch so viel im Kleinwohnen gekocht wird.
Das Mock-up-Projekt «vacancacy – no vacancy» stand 2019/20 auf dem Dach eines Gebäudes des Campus Hönggerberg der ETH Zürich. (Foto: © Edelaar Mosayebi Inderbitzin)
Was hat Sie am Vergleich mit den Wohnformen aus der Periode zwischen 1945 und 1975 interessiert? Ging es auch darum, etwas zu lernen für künftige Projekte? Oder waren es architekturhistorische Interessen?
Beides. Als Architekt*innen sind wir an der typologischen Erneuerung interessiert, gleichzeitig wollten wir die Gründe für spezifische architektonische Lösungen besser verstehen und historisch einordnen.
Am Anfang stand die Beobachtung, dass ja die meisten von uns in solchen Häusern aufgewachsen sind. Und das, was wir erlebt haben, prägt unsere Gewohnheiten und gibt häufig vor, was morgen sein wird. Die kleinbürgerliche Familie etwa war in dieser Zeit dominant, das kann man gut an den Grundrissen ablesen. Dies ist sicherlich ein Grund, weswegen auch noch heute dieser Typ am meisten gebaut wird, obschon die Kleinfamilie nicht mehr den Regelfall darstellt.
Wir haben in der Publikation verschiedene Kategorien des Vergleichs herangezogen, um Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen den Projekten zu finden. Betreffend den Wohnformen ist die Kategorie der «zweiten Erschliessung» interessant. Dazu muss man wissen, dass ein wichtiges Merkmal der bürgerlichen Wohnung die getrennte Erschliessung für Bewohner*innen und Personal war. Aufgrund von sozialen Verschiebungen wurde diese aber spätestens in den 1970er-Jahren aufgegeben – es gibt jedoch einige Projekte, die überraschende räumliche Erfindungen zur Einhaltung dieser tradierten Wohnvorstellung eingehen. Heute bereichern solche Lösungen die Wohnung und eröffnen andere Nutzungsmöglichkeiten.
Ein schönes Beispiel hierzu haben wir in Porto gefunden. Im Wohnhaus der Architekten Pedro Ramalho und Sergio Fernandez gibt es statt einer zweiten Treppe einen zweiten Zugang in die Wohnung über das halbgeschossig versetzte Zwischenpodest. So profitiert die Wohnung noch heute von einer wunderbaren Schnittfigur.
Wie nehmen Sie als ETH-Professorin die heutigen Studierenden wahr? Und was möchten Sie vermitteln?
Das ökologische und soziale Bewusstsein ist sicher präsenter als zu unserer Zeit. Das Architekturstudium an der ETH ist eine akademische wie auch eine professionelle Ausbildung. Ich möchte den Studierenden vermitteln, kritisch zu denken und auch praktisch zu handeln. Ersteres gilt den uns anvertrauten Aufgaben. Das Praktische meint ein breites entwerferisches und konstruktives Wissen und Können. Später im Beruf sind beide Aspekte grundlegend.
In Ihre Lehrpraxis integrieren Sie auch andere Disziplinen und laden etwa Künstler*innen und Naturwissenschaftler*innen ein. Was möchten Sie damit den Studierenden mitgeben?
Ich habe bereits an anderer Stelle betont, dass die Idee der Autonomie der Architektur nicht trägt. Architektur war schon immer ihrem Wesen nach interdisziplinär. Um eine Metapher der Philosophin und Wissenschaftstheoretikerin Donna Haraway zu nutzen: Wir Architekt*innen müssen fähig sein, unsere Projekte in Fadenspielen zu entwickeln. Im Studio machen wir dieses vielschichtige Netz sichtbar und kultivieren den Austausch. Zuletzt mit dem Künstler Taiyo Onorato und mit der Professur für nachhaltiges Bauen von Guillaume Habert.
Diese Studierendenarbeit entstand im Rahmen der Zusammenarbeit mit dem Künstler Taiyo Onorato. (Arbeit von Ansgar Kellner, Nicolas König und Lewis Horkulak)
Sie haben auch mehrmals das Thema des Narrativs aufgenommen. Wie man etwas kommuniziert, scheint mir auch eine wichtige Frage im Architekturdiskurs zu sein. Welche Rolle spielt das in Ihrer Praxis als Architektin?
Narrative sind für uns wichtig, um Projekte zu entwickeln und zu vermitteln. In der Architektur sprechen wir erst seit Kurzem über sie. Ich habe 2018 in werk, bauen + wohnen einen Artikel dazu geschrieben. Das Narrativ stellte ich der Idee des Konzepts gegenüber, das ich anders als das Narrativ als top-down, monokausal und selbstreferenziell bezeichne. Das Narrativ ist der sprichwörtliche rote Faden einer Geschichte, der sehr viele Details aufnehmen kann. Gute Narrative spinnen spannungsvolle Erzählfiguren und – was noch wichtiger ist – sie werden von anderen aufgenommen, verstanden und weitererzählt.
Die Schriftstellerin Ursula K. Le Guin hat das in einem Text sehr schön beschrieben: Sie sprach von der Tragetaschentheorie der Fiktion. Sie stellte dabei die Sammlerin dem Jäger gegenüber und schlägt neue Erzählstrukturen jenseits des Heldenepos vor. Analog dazu bin ich überzeugt, dass eine Idee alleine das architektonische Projekt nicht trägt, vielmehr geht es beim Entwerfen darum, viele grosse und kleine Ideen und Entscheide in einem Projekt sinnvoll zu verdichten.
Im Text von Ursula K. Le Guin geht es ja auch um die Geschlechterfrage. Wie sehen Sie das? Auch in Bezug auf die Architektur.
Mich inspiriert der Text von Ursula K. Le Guin, weil sie vom Finden, Sammeln und Ordnen von Dingen schreibt, die vielleicht auf den ersten Blick nicht zusammengehören. Das lässt sich sehr schön auf das Entwerfen übertragen. Auch hierbei müssen wir die vielen städtebaulichen Vorgaben und baurechtlichen Prämissen, das Wissen der Expert*innen sowie das Programm in ein schlüssiges Narrativ verwandeln. Solche narrativen Strukturen sind multiperspektivisch und dadurch hoffentlich vielfältiger und letztendlich vermutlich auch resilienter.
Aber leider besteht in der Disziplin das Ungleichgewicht zwischen den Geschlechtern immer noch, und ich würde sagen, das Heldenepos ist nach wie vor dominant.
Elli Mosayebi ist seit 2018 Professorin für Architektur und Entwurf an der ETH Zürich. (Foto: privat)
Abschliessend möchte ich nochmals auf Ihr neues Buch[1] zurückkommen, das demnächst erscheint. Wie steht die Schweiz im internationalen Vergleich da bezüglich Ihrer Recherche zu Wohnformen?
Im Buch haben wir keine Schweizer Stadt untersucht. Aber selbst wenn die Schweiz keine Kriegsschäden hinnehmen musste, war der Bauboom in der Hochkonjunktur ebenfalls stark und die Wohnformen sind vergleichbar. Staatlich geförderter Wohnungsbau wurde damals wie heute realisiert. In Zürich entstanden in der Zeit die städtischen Hochhäuser Heiligfeld oder Lochergut. Beide Beispiele waren bei Fertigstellung innovative Projekte und sind heute noch sehr beliebt.
Die aktuellen Diskussionen etwa in Deutschland oder Frankreich zur Wohnungsfrage kreisen viel zu stark um Quantitäten und thematisieren dabei viel zu wenig die Qualitäten des Wohnens – egal für wen. Indem wir auf die Blütezeit des Wohnungsbaus in Europa hinweisen, möchten wir auch die notwendigen Qualitäten thematisieren. Darüber hinaus sind einige der abgebildeten Projekte vom Abriss bedroht.
[1] Die Buchvernissage findet am 7. März um 19 Uhr im Architekturforum Zürich statt (Zollstrasse 115, 8005 Zürich). Zum Programm gehört eine Podiumsdiskussion mit den Herausgebenden Elli Mosayebi und Michael Kraus sowie den Autorinnen Karin Šerman, Jana Horvat (beide vom Department für Geschichte und Theorie der Architektur der Universität von Zagreb) und Irina Davidovici (gta Archiv der ETH Zürich).
Doppelseite aus dem Buch «The Renewal of Dwelling» (Foto: © Triest Verlag)
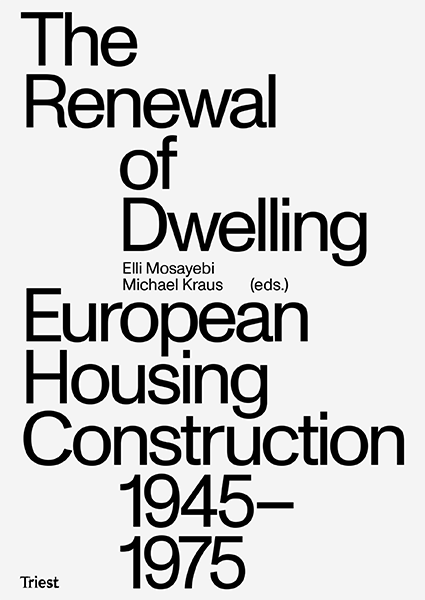
The Renewal of Dwelling. European Housing Construction 1945–1975
Elli Mosayebi und Michael Kraus (Hrsg.)
220 x 310 Millimeter
396 Pagina's
600 Illustrations
Fadengeheftete Broschur mit Schutzumschlag
ISBN 978-3-03863-038-8
Triest
Purchase this book





